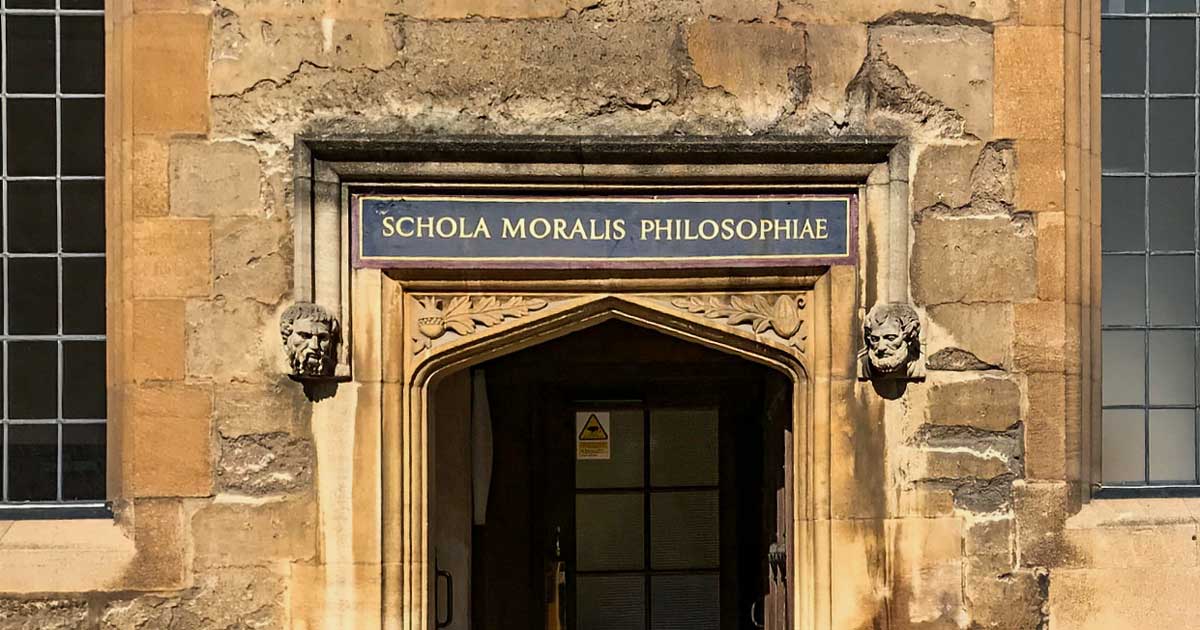In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung gewinnt die Moral für viele Menschen an Bedeutung – oft als letzter gemeinsamer Halt. Christof Gramm warnt jedoch vor einem neuen Moralismus, der selbst zum Spaltpilz werden kann. Moralische Gewissheiten seien selten eindeutig; gefordert sei nicht „mehr Moral“, sondern mehr moralische Bescheidenheit – und das Vertrauen, dass nicht alles allein vom Menschen abhängt.
Moralifizierung
Warum Moral den Glauben nicht ersetzen kann
Christof Gramm
Wieviel Moral brauchen wir? In einer Zeit, in der viele Gewissheiten verschwinden und die Gesellschaft immer differenzierter und komplexer wird, gewinnt die Moral für viele einen besonderen Stellenwert. Tatsächlich ist unsere Welt jedenfalls in Europa überwiegend frei, bunt und divers. Diese Vielfalt hat viele Vorteile, aber auch Kehrseiten. Eine Kehrseite ist, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sich auch in Deutschland auf nahezu allen Feldern des Lebens immer mehr voneinander entfernen (z. B. bei Politik, Weltanschauung und Religion, Lebensstil). Die alte biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel und das gleichnamige Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren sind auf heute projiziert zwar überzeichnet, aber in der Tendenz hochaktuell. Dort gibt es schließlich keinen Zusammenhalt mehr, kein gemeinsames Projekt, keine gemeinsame Sprache und kein Verstehen untereinander, sondern man findet sich weit voneinander entfernt in der Fläche. Die Fliehkräfte sind stärker als die zusammenführenden Kräfte. Wo aber ein gemeinsamer Bezugspunkt fehlt, meinen heute viele, dass die Moral es richten soll. Wenigstens hier wähnen sie sich auf sicherem Gelände. Der Kompass der Moral (bzw. die Ethik oder die Grundwerte, in diesem Beitrag wird zwischen allen drei nicht scharf unterschieden) und die moralische Empörung sollen uns retten und uns Zusammenhalt geben.
Aktuell beklagt beispielsweise die eher dem linken Spektrum zuneigende Autorin Anne Rabe in ihrem Buch Das M‑Wort – Gegen die Verachtung der Moral den Verfall der Moral in der Spaßgesellschaft. Sie sieht in der Abkehr von der Moral, in der Diskreditierung der „Gutmenschen“ und in der Orientierung an der vermeintlich schlechten Realität die Hauptursachen für den Rechtsruck in der Gesellschaft. Tatsächlich lassen sich in unserer Gesellschaft mit guten Gründen moralische Erosionsschäden beklagen, z. B. Verrohungstendenzen in den sozialen Medien, aber auch im Umgang miteinander, einen Mangel an Respekt im Alltag, trickreiches Lügen und Betrügen und ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit oder maximal ichzentrierte und rücksichtslose „Wohlstandsverwahrlosung“.
Viele, die an die Macht der Moral glauben, übersehen allerdings, dass die Moderne auch vor der Moral nicht halt macht. Die Moral ist keineswegs der feste gesellschaftliche Grund, sondern sie ist ebenso „divers“ wie vieles andere auch. Abgesehen davon, dass es die eine Moral ohnehin nie gab, gibt es diese heute erst recht nicht. Viele ganz unterschiedliche moralische Ansätze konkurrieren miteinander und widersprechen sich nicht selten. Schon lange gibt es die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik oder zwischen Utilitarismus und deontologischer Ethik, die bei praktischen Fragen jeweils zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen können. Heute sind viele neue „Moralen“ und Werte hinzugekommen. Die Auffindung immer neuer moralischer Grundlagen und die Ausweitung moralischer Imperative machen die Sache nicht besser. Ein weiterer Effekt ist, dass inzwischen viele Sachdebatten vor allem unter moralischem Vorzeichen diskutiert werden. Die Moralifizierung vieler Lebensbezüge, zum Beispiel bei Ernährung, Wohnen, Reisen, Energie, Verkehr, Sprache, Freizeitverhalten usw., steigert die moralische Erhitzung. Die gesellschaftlichen Folgen, die die einen als besonders fortschrittlich begrüßen und die die anderen abstößt, werden von den Moralisten selten in ihrer Ambivalenz gesehen. Aktuelles Beispiel: Die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin wird von den einen als moralischer Sieg über den Rassismus der unreflektierten Masse gefeiert. Manche andere flüchten sich dagegen ins Ressentiment. „Dagegen“ zu sein, grollend, wütend und manchmal hasserfüllt, ist salonfähig und hat längst eine eigene kollektive Identität ausgebildet, die ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt und die für viele anschlussfähig ist. Die Sachlichen, die erkennen, dass es auch gute Gründe für die Beibehaltung des Namens gibt, ohne deswegen Rassist zu sein, kommen gar nicht mehr richtig in den Blick.
Wenn man überzogenen Moralismus einerseits und ressentimentgeladenes Dagegensein andererseits vermeiden möchte, folgt daraus vor allem eines: die Pflicht zur moralischen Bescheidenheit. Das meint allererst Vorsicht mit moralischen Absolutheitsansprüchen. Gegen moralische Absolutheitsansprüche spricht alleine schon, dass wir uns immer irren können. Zuviel Selbstgewissheit schadet. Hinzu kommt, dass viele Streitthemen und viele Sachfragen nicht in erster Linie moralisch zu entscheiden sind. Und nicht jede Position, die mir persönlich moralisch falsch erscheint, ist deswegen schon außerhalb jeder Moralität. Weiter hinzu kommt, dass viele Streitfragen moralisch betrachtet keineswegs immer so eindeutig sind wie manche tun, sondern häufig bedürfen verschiedene widerstreitende Werte und Prinzipien erst der Abwägung. Dabei kann man, manchmal sogar aufgrund der gleichen moralischen Prinzipien, zu ganz unterschiedlichen, ja sogar konträren Überzeugungen gelangen, zum Beispiel bei einigen Top-Streitthemen wie der Sterbehilfe oder dem Schutz des ungeborenen Lebens. Einfache Antworten gibt es hier nicht. Selbst der hohe Wert der Menschenwürde ist dabei zwar eine wichtige Argumentationshilfe, aber eben auch nicht viel mehr. Es wird gerne übersehen, dass auch die ganz großen Werte für konkrete gesellschaftliche Streitfragen in moralischer Perspektive oft gerade keine eindeutige Antwort bereithalten. Bei der Sterbehilfe wird das besonders deutlich. Menschenwürde, Selbstbestimmung und der Schutz des Lebens kollidieren miteinander, und es gibt kein eindeutig vorgegebenes Ergebnis. Auch in anderen Fällen gibt es oft keine moralisch absolut zwingende Lösung, zum Beispiel bei der Frage nach der richtigen Sicherung des Friedens, sondern hier konkurrieren verschiedene Sichtweisen, die alle moralische Argumente für sich in Anspruch nehmen können. Das gilt nicht nur für Pazifisten, sondern auch für diejenigen, die den bewaffneten Frieden für den besseren Weg halten. Nur ein vollkommen unkritischer, geradezu vormoderner Ansatz bildet sich ein, diese Schwierigkeit mit der Forderung nach „mehr Moral“ überspringen zu können. Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit ist zwar verständlich, gerade wenn vieles andere sich als unsicher erweist, aber in der Sache oft alles andere als realistisch.
Bei dem Ruf nach mehr Moral geht es bei aller Emphase oft genug um das, was man selbst für moralisch hält. Mit der verständlichen Sehnsucht nach Gewissheit ist allerdings nichts gewonnen. Die Fronten verhärten sich dadurch nur noch mehr, vor allem wenn man dem anderen von vornherein abspricht, dass seine Position vielleicht auch gute moralische Argumente für sich beanspruchen kann. Denn selbst die beste Moral, die es als konkurrenzlose Moral ja ohnehin nie gab, ist oft wenig konkret. Mit dem Fluch fehlender Eindeutigkeit müssen wir in der Moderne leben, leider auch auf dem Feld der Moral. Die praktischen gesellschaftlichen Folgen des Rufes nach „mehr Moral“ sind enorm. Diese Forderung befeuert das alte, im Ursprung religiöse Spiel zwischen Rechtgläubigen und Häretikern, nur dass es dabei – zumindest auf den ersten Blick – nicht um religiöse Inhalte und Überzeugungen geht, sondern um moralische Standards. In einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft ist das folgerichtig. Wo sich die Frage nach Gott überwiegend erledigt hat, verlagert sich der Streit über die richtigen Glaubensinhalte häufig auf andere Felder, insbesondere auf das Feld der Moral. Im fortgeschrittenen Säkularismus bildet die Moral für viele eine Religion. Eine ausgeprägte moralische Sensibilität gilt dann geradezu als Beleg für säkulare (Recht-) Gläubigkeit. Ausgrenzender Moralismus mit Absolutheitsanspruch kann aber nicht die Lösung sein.
Dieser gesellschaftliche Trend macht längst auch vor der Kirche nicht halt. In der evangelischen Kirche gibt es Tendenzen, Gott durch Moral zu ersetzen. Auch hier sind die theologischen Konsequenzen gewaltig. Denn plötzlich kommt es nicht mehr auf das Handeln Gottes in dieser Welt an, an das in der Kirche viele sowieso nicht mehr glauben, sondern nur noch auf das Handeln der Menschen. Unser Schicksal und das Heil der Welt hängen dann ausschließlich vom richtigen Handeln und der richtigen handlungsleitenden Moral der Menschen ab, Erlösung hier und jetzt, „auff das sich das yrdische Leben schwenke in den Himmel“ (so schon der Zeitgenosse Luthers Thomas Müntzer). Ralf Frisch weist darauf hin, dass sich das theologisch heute an dem Satz festmachen lässt: „Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände“ (Dorothee Sölle). Religion und der Glaube an Jesus Christus mutieren dadurch zum revolutionären Weltverbesserungsprojekt. Das Heilige verschwindet hinter einer Moral mit weltveränderndem Anspruch. Auch bei Klimaaktivisten und in der Generation Z sind solche Gedankengänge populär, deutlich etwa bei Luisa Neubauer: „Gott wird uns nicht retten.“ Anders gewendet heißt das: Also müssen wir es tun. Es geht hier nicht nur darum, moralisch gut zu handeln, sondern Moralität wird zum säkularen Selbsterlösungsprojekt. Die Erlösung von allen Übeln ist allein unsere Aufgabe. Vom Vertrauen in das erlösende Handeln Gottes findet sich hier nichts mehr. Folgerichtig beziehen manche gesellschaftlichen Kräfte heute ihre moralische Energie aus der wütenden Überzeugung: „Wir müssen jetzt den uns sonst sicher bevorstehenden Weltuntergang stoppen.“ Apokalyptisch aufgeladene Ansätze neigen ja schon immer zu radikalen Einschnitten in die wirkliche Welt. Die Pose der selbsternannten Weltenretter ist dabei meistens nicht nur überzogen, sondern mitunter hochgefährlich, zum Beispiel auch, wenn ein Peter Thiel sich berufen fühlt, als verlängerter Arm Gottes die Apokalypse aufzuhalten, oder – auch nicht besser – sie mit Wucht herbeizuführen, um dem Guten im letzten großen Kampf auf Erden zum Durchbruch zu verhelfen. Endkampfbesessenheit war schon immer ein gefährlicher Antrieb.
Praktisch führen diese Formen moralischer Aufladung nicht nur zu gesellschaftlicher Überhitzung und Spaltung, sondern zu einer enormen Selbstüberforderung und Selbstüberschätzung. Die Menschen haben ja schon des Öfteren versucht, die Welt durch die richtige Moral zu retten und das Paradies auf Erden zu errichten, mal mit, mal ohne Berufung auf Gott, aber meistens mit katastrophalem Ausgang. Wer heute noch ungebrochen auf die Moral und die heilende Kraft des Menschen setzt, hat die Gegenwart und die Geschichte insbesondere des 20. Jahrhunderts schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen – und viele biblische Texte auch nicht. Dies ist selbstverständlich kein Appell zur Unmoral, zum totalen Relativismus oder dazu, die Hände selbstgenügsam in den Schoß zu legen. Vieles ist moralisch eindeutig, zum Beispiel bei Kriegsverbrechen. Vieles aber auch nicht. Wir müssen dann um moralisch tragfähige Lösungen streiten. Wir sollten dabei aber nicht so tun, als wenn die Moral in ihren konkreten Konsequenzen immer so eindeutig wäre. Das als moralisch richtig Erkannte kann gerade in gesellschaftlichen Streitfragen immer nur das Ergebnis eines harten Ringens sein. Moralische Vereinfachung und die unterkomplexe und populistische Forderung „zurück zur Moral“ führen in eine Sackgasse, ebenso wie die permanente Ausweitung des Moralischen und die Aufdeckung immer neuer moralischer Imperative. Es ist eine Illusion, dass eine wie auch immer geartete Moral uns in einer Zeit, in der vieles in Frage gestellt wird, sicheren Halt geben kann. Die Welt ist auch in moralischer Hinsicht weniger gewiss als wir gerne meinen möchten. Mehr moralische Bescheidenheit und weniger Populismus wären hilfreich.
Bei allem Bemühen um den richtigen Weg sollten wir Moral einerseits und Religion, Gott, das Heilige und die Liebe andererseits keinesfalls verwechseln – und schon gar nicht gegeneinander austauschen. Auf dem Feld der Moral kann niemand darauf vertrauen, dass alles gut werden wird. Man kann es auch so sagen: Moral ist keine Sache des Vertrauens, sondern in der Praxis des wirklichen Lebens eine Sache des Machens und des Wettbewerbs. Wettbewerb und Konkurrenz bedeuten immer auch Kampf: Was ist die beste Moral, wer ist moralisch besonders gut, und vor allem wer kann sich mit seinen moralischen Vorstellungen durchsetzen? Bei Gott ist das radikal anders. Mich und meine moralischen Vorstellungen durchzusetzen hilft bei Gott überhaupt nichts, sondern bei ihm kann ich nur darauf vertrauen, dass er die Dinge eines Tages, in welcher Form auch immer, zum Guten wenden wird. Und der Wille Gottes ist bestimmt nicht immer identisch mit meinen moralischen Vorstellungen. Wo Gott auf das moralisch gute Handeln der Menschen reduziert wird oder gar darauf angewiesen ist, wird er auf menschliches Maß verkleinert. Deswegen heißt es ja auch völlig zu Recht „und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne“. Das meint auch: Höher als meine Vorstellungen von Moral. Das Vertrauen in das für uns nicht immer verständliche Handeln – und manchmal auch Nichthandeln – Gottes sollten wir uns als Christen nicht nehmen lassen, schon gar nicht durch die Forderung nach „mehr Moral“.