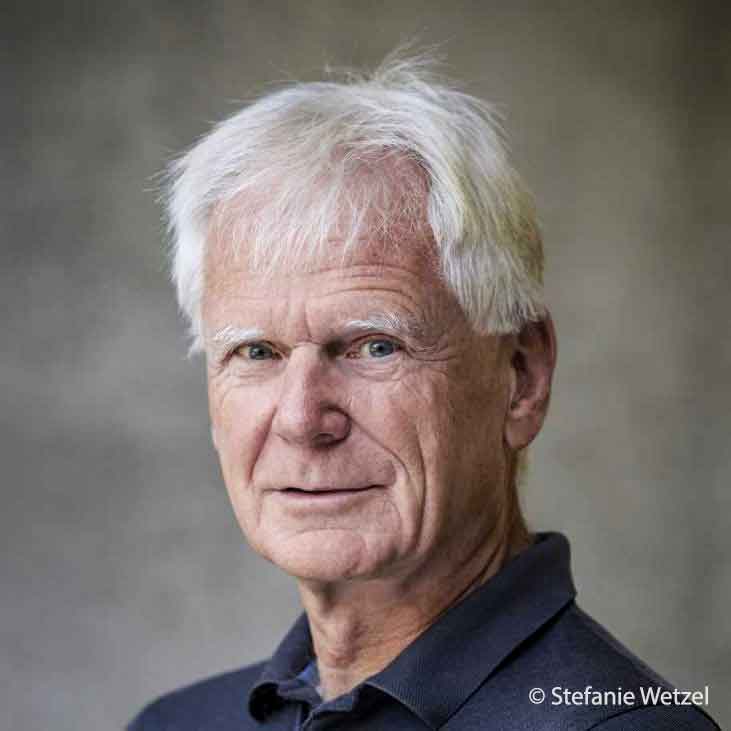Jürgen Habermas warnt vor einer „Verflachung der christlichen Glaubensgehalte“. Ingolf U. Dalferth nimmt diesen Einwand ernst und widerspricht einer „transzendenzabstinenten“ Religionspraxis, die Glauben und Hoffnung auf bloßen Vollzug reduziert. Sein Essay zeigt, warum christliches Hoffen ohne inhaltliche Bestimmtheit in die Irre führt – und weshalb Habermas’ Einspruch theologisch berechtigt ist.
Der Irrweg der Transzendenzabstinenz
Habermas zu religiösem Glauben und Hoffen
Nein, es gibt keine neue Habermas-Debatte.1 Dass Habermas auf Transzendenz pocht, ist nicht neu2 – er tut es ja nicht aus philosophischen Gründen, sondern als Interpret von Glauben und Religion. Die „strikte Trennung zwischen Glauben und philosophischem Wissen“ ist für ihn „selbstverständlich“3; aber Glaube und Religion sind für ihn, wie für viele, unlöslich mit Transzendenz verknüpft. Religion ohne Transzendenzbezug ist für ihn so abwegig wie Kaffee ohne Kaffeebohnen, ein bloßer Muckefuck oder „Mocca faux“ eben, der vielleicht wie Kaffee aussieht, aber keiner ist. Eine „Religion“, die nur noch so heißt, aber keine mehr ist, weil sie mit dem Transzendenzbezug auch „ihren bestimmten Inhalt oder Gegenstand“ verloren hat,4 ist unbrauchbar als Moralressource für eine nachmetaphysische Gesellschaft. Sie bietet nichts, was man sich säkular aneignen könnte. Auf sie kann man ohne Verlust verzichten.
Es sind daher die altbekannten Gründe, die Habermas in seinem Geburtstagsgruß in der Festschrift für Thomas M. Schmidt bewogen haben, auf Transzendenz und inhaltliche Bestimmtheit zu pochen. Seine Anmerkungen kommentieren Schmidts „düstere Diagnose“5 in einem Aufsatz „Religion als Quelle der Normativität“, der 2024 in einem Sammelband über das Spätwerk von Jürgen Habermas Auch eine Geschichte der Philosophie erschienen war.6 Schmidt gibt dort eine „äußerst skeptische Antwort auf die Frage, ob die christliche Religion hier, in den entwickelten Gesellschaften des Westens, überhaupt noch eine ‘gegenwärtige Gestalt des Geistes darstellt, die als sakrale Quelle sozialer Integration ein Anregungspotential für die nachmetaphysische Vernunft und moderne Gesellschaft darstellt’“. Ihm zufolge gibt es dafür wenig Hoffnung. „Wenn sich durch Digitalisierung die Verbreitung und Verwendung theoretischen Wissens von verständigungsorientierten Prozessen abkoppelt, kann dann ein sakraler Komplex, dessen liturgische Formen immer noch um Texte und ihre analoge Rezeption zentriert sind, diese Form des Weltwissens noch produktiv verarbeiten und ihre Pathologien kompensieren?“7
In einer Welt digitaler Kommunikation ist die christliche Religion mit ihren Dogmen und kirchlichen Ritualen ein Fremdkörper. Sie trägt zur modernen Wissensgesellschaft nichts bei und ihr sakraler Gehalt besitzt kein Potential zur individuellen Lebensorientierung und sozialen Integration in einer digital kommunizierenden nachmetaphysischen Gesellschaft. Institutionell und individuell wird die christliche Religion irrelevant, weil sie keine Funktion mehr hat, nicht einmal als Moralressource.
Nun liegt nicht auf der Hand, warum Religion nur dann Beachtung verdienen sollte, wenn sie eine Funktion erfüllt und einen Bedarf deckt, der unabhängig von ihr in der Gesellschaft besteht. Könnte sie nicht auch ein Selbstzweck sein und nicht nur als Mittel für etwas anderes dienen? Muss sie als Antwort auf Fragen verstanden werden, die Menschen sich stellen, oder kann sie nicht auch als Anstiftung zu Fragen verstanden werden, die Menschen sich sonst nicht stellen? Die zunehmende Irrelevanz der christlichen Religion im Wohlstandswesten lässt sich jedenfalls nicht dadurch überwinden, dass man sie digitalisiert, ihre Traditionsvermittlung also von analoger auf digitale Kommunikation umstellt, wie derzeit viele versuchen. Man wird nicht dadurch relevant, dass man das auch tut, was andere tun. Es geht nicht nur um Inhalte (also Möglichkeiten), sondern um Vollzüge (also Wirklichkeiten), nicht nur um theoretische Einsichten, sondern um Lebenspraxis. Gelebter Glaube aber ist mehr und anderes als digital oder analog kommuniziertes Glaubenswissen in Drittpersonperspektive. Ohne existenzielle Aneignung und Mitvollzug in der Erstpersonperspektive gibt es ihn nicht.
Damit aber stellt sich ein Problem, das die analytische Unterscheidung zwischen fides qua creditur und fides quae creditur aufwirft, aber nicht löst. Man kann die fides quae creditur theologisch thematisieren, ohne sich auf die fides qua creditur einzulassen. Man kann auch die fides qua creditur psychologisch analysieren, ohne sie selbst zu vollziehen. Von diesen Möglichkeiten zehren die wissenschaftliche Theologie und Religionswissenschaft der Moderne. Aber gilt auch das Umgekehrte? Kann man eine fides qua creditur mitvollziehen, ohne sich auf die dazugehörige fides quae creditur einzulassen? Mit den kognitiven Gehalten des Glaubens und ihrer rituellen Vergegenwärtigung in Gottesdienst und Lebenspraxis kann man sich wissenschaftlich distanziert auseinandersetzen, ohne diesen Glauben zu praktizieren. Aber kann man ihn auch praktizieren, ohne sich zu seinen Gehalten, Inhalten und Gegenständen zu verhalten?
Habermas zufolge legt Schmidt eben das nahe. Nicht die Anpassung der christlichen Religion an digitale Formen der Kommunikation ist der von ihm favorisierte Weg in die Zukunft, sondern die Entkoppelung religiöser Glaubenspraxis von den Inhalten der christlichen Tradition. Der Vollzug sei entscheidend, nicht der Inhalt. Wer heute glauben will, muss es in post-(mono)theistischer Weise tun.8 Religion könne unter gegenwärtigen Bedingungen nur dann eine ernsthafte Option sein, wenn sie sich „von Jenseitsvorstellungen und Erlösungshoffnungen“ befreit und ganz auf den Vollzug beschränkt. Doch kann es eine fides qua creditur geben, ohne eine fides quae creditur? Sind nicht beide Aspekte in jedem konkreten Glaubensvollzug intrinsisch aufeinander bezogen?
Habermas findet bei Schmidt (und von Sass, den er auch zitiert,9) auf diese Frage nur eine negative Antwort: Wer den richtigen Vollzug will, muss sich von den falschen Inhalten lösen. Von der „Gefahr eines Abgleitens in einen spirituellen ‘Erlösungsnarzismus’ der ‘Selbstsakralisierung’“ sei das gegenwärtige religiöse Bewusstsein nur zu bewahren, wenn es nicht länger „am dogmatischen Kern einer monotheistischen Erlösungsreligion festhält“, sondern sich „von einer Jenseitsorientierung und dem expliziten göttlichen Erlösungsversprechen verabschiedet.“10 Nicht dem christlichen Glauben und seinen Inhalten, sondern den selbsttranszendierenden Vollzügen spirituellen Hoffens sei Priorität einzuräumen. Religiöse Glaubenspraxis habe nur eine Zukunft, wenn sie ihre Zuversicht nicht aus dem überkommenen dogmatischen Erlösungsglauben beziehe, sondern aus „spirituell erneuerten Hoffnungen …, auch wenn diese sich nicht mehr auf die Glückseligkeit einer alles Innerweltliche transzendierenden Erfüllung richten”.11 Hoffnungsvoll leben sei wichtiger als etwas Bestimmtes glauben. Man könne hoffen, ohne auf das zu hoffen, was der Glaube glaubt.12 Der Vollzug des Hoffens sei das Entscheidende der religiösen Praxis, nicht die Glaubensinhalte der christlichen Tradition. Denn Hoffen als Vollzug sei Selbsttranszendieren in eine Praxis der Nächstenliebe hinein, die ihre Kraft aus nichts anderem als der Verstetigung dieses Hoffens beziehe.
Das ist der Punkt, den Habermas aufgreift. Er fragt, was an „einer atheistisch-unbestimmten, auf ekstatisch evozierten Hoffnungs-Schüben basierenden Glaubenspraxis“ denn religiös sein soll.13 Wenn sich die Hoffnung auf nichts richtet, was macht sie dann zur Hoffnung oder gar zur religiösen Hoffnung? Nicht an dem kleben, was man geworden ist, sondern sich für das öffnen, was man noch nicht ist, ist für Habermas nicht genug. Und warum dieses ekstatische Hoffen in eine Haltung und Praxis der Nächstenliebe münden soll, leuchtet ihm nicht ein. Ihm fehlt in diesem Selbsttranszendierungsmodell die existenzielle Orientierung. Eine inhaltlich unbestimmte Hoffnung, „die einen religiösen Charakter behalten soll“ könnte sich allenfalls „einer autobiographischen Erinnerung an die Hoffnungszustände einer einmal vitalen, inzwischen jedoch entglittenen, ‘gläubigen’ Existenzweise“ verdanken, „die auf die Konstellation von Glaube, Liebe und Hoffnung gegründet war. Daran kann sich jedoch nur erinnern, wer diesem Glauben angehangen und ihn dann verloren hat. Das würde den Kreis der Adressaten der Lehre einer ‘neuen’ – aus meiner [d.h. Habermas’] Sicht paradoxen – Hoffnungspraxis jeweils auf den Kreis ‘letzter’ Christen einschränken, die unter dem Verlust ihres Glaubens leiden.“14 Eine Hoffnung, die nichts mehr erhofft, ist paradox, und ein Glaube, an den man sich bloß noch als das erinnert, was man nicht mehr hat, ist noch nicht einmal für die von Bedeutung, die ihn verloren haben. Man hofft nicht, wenn man nichts hofft, und man glaubt nicht, wenn man sich nur noch an Verlorenes erinnert und daran leidet, dass man es nicht mehr hat. Den Vollzug beibehalten wollen, aber auf alle inhaltliche Bestimmtheit verzichten, ist ein Unding. Bloßes Hoffen ist kein Hoffen, und bloßes Glauben kein Glaube.
Nicht die Vorordnung des Glaubens vor die Hoffnung oder der Hoffnung vor den Glauben ist Habermas zufolge daher entscheidend, sondern wie man Hoffen und Glauben versteht. Man kann auf etwas hoffen (hoffen-dass), für oder mit jemand hoffen (hoffen-für bzw. hoffen-mit) oder auf jemand (hoffen-auf). Man kann auch etwas glauben (glauben-dass), jemand glauben (Glauben schenken) oder an jemanden glauben (glauben-an). Aber man kann nicht einfach hoffen, ohne auf etwas, für jemand oder auf jemand zu hoffen, und man kann nicht glauben, ohne etwas, jemand oder an jemand zu glauben. Mit jeder dieser Konkretionen verbinden sich Bestimmtheiten, die man nicht einfach ausblenden kann, ohne das ganze Phänomen zu verlieren. Es gibt kein unbestimmt-neutrales Glauben oder Hoffen, das man auch dann vollziehen könnte, wenn man das überkommene Christentum hinter sich gelassen hat. Wer an den christlichen Inhalten nicht festhalten kann oder will, kann den Vollzug als religiöse Spiritualitätspraxis nur beibehalten, wenn er ihn mit anderen Inhalten verknüpft. Es gibt kein „neutrales“ inhaltsfreies Glauben und Hoffen als reine Performanz. Die durch Negation, Ausblendung und Bestreitung erzeugte Unbestimmtheit des Glaubens und Hoffens ist vielmehr das weit offene Einfallstor für alle möglichen anderen Bestimmtheiten im Leben von Menschen. Wer das Christentum hinter sich lässt, kommt nicht in der selbstbestimmten Freiheit des eigenen Existenzvollzugs an, sondern in der Fremdbestimmtheit durch die Erwartungen und Selbstverständlichkeitsunterstellungen des Zeitgeists seiner jeweiligen Kultur.
Der Versuch, sich unter Absehung von aller inhaltlichen Bestimmtheit auf den bloßen Vollzug des Hoffens und Glaubens zurückzuziehen, ist daher ein Irrweg. Ein inhaltsfreier, rein performativer Vollzug ist ein abstraktes Gedankenkonstrukt, weil es im konkreten Leben kein gänzlich unbestimmtes Vollziehen und kein völlig leeres Hoffen oder Glauben gibt. Man ist in Wirklichkeitszusammenhänge, Zeitstrukturen, Traditionen und Ortsgegebenheiten eingebunden, die das Hoffen und Glauben mitprägen. Man kann sich verschieden zu ihnen verhalten, aber man kann sich ihnen nicht völlig entziehen. Wenn man sich von den einen löst, gerät man in den Bann von anderen. Das eröffnet Spielräume der Unbestimmtheit, aber es erspart einem nicht, in je bestimmter Weise zu glauben und zu hoffen, sich also nicht nur um Vollzüge zu kümmern, sondern auch auf Inhalte einzulassen.
Minimales kann da schon folgenreich sein. Wer hofft, muss sich nicht auf Zukünftiges beziehen, aber er kann nicht hoffen, ohne mit der Möglichkeit des Guten zu rechnen. Dazu ist man angesichts der Realitäten des Lebens und der Welt nur allzu häufig nicht in der Lage. Als Modus menschlichen Daseins ist hoffen können ein Geschenk, das man sich ebenso wenig selbst verschaffen kann wie das eigene Dasein. Man braucht die Zuversicht, dass im Leben mehr geschieht als das, was man selbst erlebt und tut und zusammen mit anderen erfährt und anrichtet. Diese Zuversicht manifestiert sich nach christlicher Überzeugung im Setzen auf Gott, dem alle ihr Dasein, ihre Möglichkeiten und die Überraschung durch unerwartet Gutes verdanken. Man muss das nicht glauben, damit es wahr ist, sondern man kann es glauben, weil es wahr ist, auch wenn man es nicht glaubt. Nicht das, was man hofft, ist daher entscheidend, sondern der, auf den man hofft. Die christliche Hoffnung hat ihre post-metaphysische Pointe nicht darin, dass sie reiner Vollzug ist, aber nichts erhofft, sondern dass sie auf den hofft, ohne den es weder die Möglichkeit des Guten, auf die sie setzt, noch sie selbst gäbe.
Wer deshalb meint, es könne eine christliche Praxis des Hoffens geben, ohne das Hoffen an dem auszurichten, auf den der Glaube sich bezieht, weil er sich ihm verdankt, der irrt. Und wer meint, man könne auch ohne Glauben hoffen, weil man nicht mehr glauben kann, was man einst geglaubt hat, der steht in Gefahr, seine Glaubensgewissheit mit der Gewissheit des Glaubens zu verwechseln. Die erste richtet den Blick auf den, der glaubt, die zweite auf den, ohne den man weder glauben noch zweifeln könnte. Gottesgewissheit ist deshalb etwas anderes als Selbstgewissheit. Sie geht im Zweifel nicht unter, weil man nicht einmal zweifeln könnte, wenn sie nicht wahr wäre. Wer auf Gott setzt, braucht nicht auf sich selbst zu setzen. Er ist frei – von sich selbst. Erst damit aber beginnt christliches Glauben und Hoffen. Das Christentum lebt von der Wahrheit des Glaubens, nicht der Gewissheit der Glaubenden, von der Zuverlässigkeit Gottes, nicht der eigenen Glaubensgewissheit, von der Hoffnung auf Gott, nicht vom leeren Hoffen. Insofern Habermas’ Einspruch gegen transzendenzabstinente Religionskonzepte das im Blick hat, hat er Recht.
Endnoten
- Christian Geyer, Bischöfe aufgepasst! Jürgen Habermas pocht auf Transzendenz, FAZ Nr. 236, 13 (11.10.2025). URL:
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/habermas-warnt-vor-verflachung-der-christlichen-glaubensgehalte-accg-110726291.html
↩︎ - Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Bd. 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen, Berlin 2019, 807. Dazu: I. U. Dalferth, Die Krise der öffentlichen Vernunft. Über Demokratie, Urteilskraft und Gott, Leipzig 2022, 161–167. ↩︎
- Jürgen Habermas, „Ein Geburtstagsgruß“, in: Michael Roseneck/Annette Langner-Pitschmann/Tobias Müller (Hrsg.), Den Diskurs bestreiten. Religion im Spannungsfeld zwischen Erfahrung und Begriff. Festschrift für Thomas M. Schmidt, Baden-Baden: Nomos 2025, 15. ↩︎
- Ebd., 18. ↩︎
- Ebd., 16. ↩︎
- Thomas M. Schmidt, „Religion als Quelle der Normativität“, in: Stefan Müller-Doohm/Smail Rapic/Tilo Wesche (Hrsg.), Vernünftige Freiheit. Beiträge zum Spätwerk von Jürgen Habermas, Berlin 2024, 13–35. ↩︎
- Habermas, „Geburtstagsgruß“, 16 (Zitat aus Schmidt, „Religion als Quelle“, 26). ↩︎
- Schmidt, „Religion als Quelle“, 26. ↩︎
- Habermas, „Geburtstagsgruß“, 16–17; sowie Hartmut von Sass, „Zwischen Verheißung und Ekstase. Hoffnung als Thema einer engagierten Theologie“, Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 57 (2015): 318–341; ferner von Sass, Außer sich sein. Hoffnung und ein neues Format der Theologie, Tübingen 2023. (Habermas merkt an, dass sich von Sass’ Position nicht auf das reduzieren lässt, was er ausführt, Habermas 18.) ↩︎
- Habermas, „Geburtstagsgruß“, 16–17. ↩︎
- Ebd., 17. ↩︎
- Ebd. ↩︎
- Ebd., 18. ↩︎
- Ebd., 19. ↩︎