Forum Kirche und Theologie:
Aktuelles
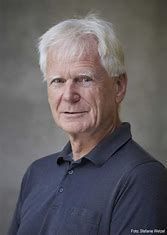
Ingolf U. Dalferth
Prof. em. für Systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie, Universität Zürich
Zur Theologievergessenheit der Theologie
Ich bin gebeten worden, aus akademischer Perspektive ein paar Worte zur „Theologievergessenheit in Theologie, Kirche und Gesellschaft“ zu sagen. Ich beschränke mich auf den ersten Punkt. Soll die Rede von der „Theologievergessenheit in der Theologie“ kein bloßer Selbstwiderspruch sein, dürfte mit „Theologie“ die akademische Theologie gemeint sein, und mit „Theologievergessenheit“ die Befürchtung, dass das, was dort erforscht und gelehrt wird, nicht das ist, was dort erforscht und gelehrt werden sollte - jedenfalls dann nicht, wenn man „Theologie“ so versteht wie im Programmtext des Forums: als Reflexion der „theologischen Grundlagen des christlichen Glaubenslebens“ – wohlgemerkt: der theologischen Grundlagen, nicht nur der rechtlichen, ökonomischen, sozialen, psychologischen usf. Grundlagen, Aspekte oder Dimensionen des christlichen Glaubenslebens, die es ja auch gibt.
Theologie im genannten Sinn muss mehr sein wollen als „Ethik, Kulturtheorie, Christentumsgeschichte oder Religionsphilosophie“, jedenfalls sofern sie christliche Theologie sein will und einen konstruktiven Beitrag zum Verstehen und zur Gestaltung christlichen Lebens in der Gegenwart leisten will. Das gelingt nicht, wenn akademische Theologie ohne Bezug auf die Aufgaben und Herausforderungen der Kirche und ihrer Evangeliumsbotschaft auskommen will, im Christentum nur einen Fall von Religion unter anderen sieht und ,Gott‘ für eine fromme Formel hält, die in der wissenschaftlichen Theologie keine Rolle spielen könne, weil sie keine methodisch ausweisbare Erklärungsleistung erbringe. Kein Wunder, dass die kirchliche Bemühung um die Gestaltung des christlichen Gemeinschaftslebens das dafür Nützliche und Hilfreiche dann überall sucht, nur nicht in der akademischen Theologie.
Sicher sind die Formeln „Kirche ohne Theologiebezug“ und „Theologie ohne Kirchenbezug“ einseitige Übervereinfachungen. Die Realität ist differenzierter zu beschreiben. Aber sie markieren Gefahren, die es zu meiden gilt. Und sie drängen sich auf, wenn Synoden oder Kirchenleitungen meinen, auf theologische Beratungsgremien verzichten zu können, oder sie, wie die EKD, durch ein „Kammernetzwerk“ ersetzt, das vor allem „Stellungnahmen zu aktuellen gesellschaftspolitischen oder ethischen Fragen“ erarbeiten soll, wenn es denn einberufen wird. Oder wenn sich Fakultäten wie Zürich ohne äußere Nötigung in theologisch-religionswissenschaftliche Einrichtungen umbenennen und ein ,rein wissenschaftliches‘ Theologieverständnis propagieren, das der religionswissenschaftlichen Aussenbeschreibung von Religionstraditionen und -gemeinschaften eine theologische Innensicht an die Seite stellen will, ohne angeben zu können, was diese Innensicht denn sein soll – und deshalb faktisch nichts anderes ist, als die jeweilige Christentumssicht der Fakultätsmitglieder.
An solchen Beispielen zeigt sich, wohin die Reise geht. Weil das Christentum als Lebensorientierung der Menschen in unserer Gesellschaft an Boden verliert und das politische Gewicht der Christen schrumpft, weil die Kirchen als moralische Instanzen (in vorhersehbarer Weise) versagt haben und als diakonisch-soziale Einrichtungen und als Bildungs-Institutionen nicht mehr so gebraucht werden wie einst, will sich mancher in der akademischen Theologie auf die Seite der Wissenschaft retten – ohne zu beachten, dass es sehr schnell keine staatlich subventionierte Theologie in Gestalt der disziplinär ausdifferenzierten theologischen Fakultäten bzw. Fachbereiche mehr geben wird, wenn man diesen Weg einschlägt. Niemand braucht so viele Lehrstühle für so wenige Studierende und so viel Personal für Fragestellungen, die nur wenige interessieren. Die Flucht in Forschungskooperationen mit kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen ist kein Rettungsweg. Ohne Ausbildungsaufgaben für ein gesellschaftlich für wichtig erachtetes Berufs- und Tätigkeitsfeld (Kirche, Schule) sind die theologischen Einrichtungen überausgestattet – es gibt zu viele und sie erhalten zu viel. Eine nicht kirchenbezogene Theologie ist ein Orchideenfach. Jede verantwortliche Universitätsleitung wird hier Einsparpotential sehen und die verfügbaren Ressourcen anders einzusetzen versuchen.
Diese Situation wird sich in nächster Zeit rechtlich und finanziell verschärfen, wenn in Deutschland die finanzielle Entflechtung von Staat und Kirche Gestalt annimmt und damit auch die Konkordatsregelungen für die katholischen und evangelischen Theologischen Fakultäten zur Disposition stehen werden. Das steht keineswegs nur auf staatlicher Seite auf der Agenda, sondern auch in der Theologie selbst (vgl. Thomas Schüller, „Unheilige Allianz.“ Warum sich Staat und Kirche trennen müssen, Hanser Verlag München 2023).
Die gesellschaftliche Rolle der Kirchen hat sich grundlegend geändert und daran wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Nichts wird so bleiben, wie es ist. Darauf gilt es sich einzustellen. Das nicht zu tun, ist nicht nur kurzsichtig, sondern verantwortungslos. Es genügt nicht, sich selbst in den Ruhestand zu retten und die Aufräumarbeiten der nächsten Generation zu überlassen. Nicht die Ausrichtung auf die Kirche ist das, was der akademischen Theologie schadet, sondern die Irrmeinung, es könne sie ohne diese Ausrichtung an den wissenschaftlichen Einrichtungen unserer Gesellschaft noch lange geben. Der gesellschaftliche Relevanzverlust der Kirchen wird sich auf die akademische Theologie auswirken, und es wird ihr nichts helfen, durch Umgestaltung zu einer a-kirchlichen Kulturwissenschaft der Innenbetrachtung von Religion(en) ihren Ort an den Universitäten retten zu wollen.
Neben die institutionell-gesellschaftlichen Probleme der akademischen Theologie treten die inhaltlichen. Einen Konsens über das, was die Theologie zu erforschen und zu lehren hat, gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Geht es um Gottesgelehrtheit, Schriftkunde, die Ausbildung kirchlicher Leitungskompetenz, Religionsforschung, Spiritualitätsmanagement, Gemeinsinnethik, Weltethos? All das wurde und wird vertreten, aber heute gibt es kaum noch einen Streit darüber – und das ist bedenklich. Man bezieht Position, aber man diskutiert nicht mehr die Positionen. Es ist ja schon beinahe komisch, wenn in Bekennermanier immer wieder der 19. Jahrhundert-Gegensatz zwischen Positiven und Liberalen beschworen oder Schleiermacher gegen Barth und umgekehrt ausgespielt wird. Wir leben im 21. Jahrhundert. Aber wir haben uns so an die Toleranzpostulate unserer säkular-multireligiösen Kultur gewöhnt, dass es zwar leicht ist, die Übel zu benennen, die der Christenheit anzulasten sind, es aber für anstößig gehalten wird, öffentlich herauszustreichen, was einer Gesellschaft ohne das Christentum fehlt, was das Kulturprojekt der Humanisierung des Menschen dem Evangelium und den Kirchen verdankt und wozu christliche Theologie nötig ist, was sie auszeichnet, was sie leistet und was nicht.
Es war schon immer leichter, das Negative zu beschreiben als das Positive zu benennen. Aber in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten stehen moralische Wertungen meist höher im Kurs als die Kenntnis dessen, was bewertet wird. Doch Werturteile, die nicht auf Sachurteile gründen, sind wenig mehr als Meinungsäußerungen, und Zustimmung zu ihnen zu fordern, fördert nicht die eigene Urteilskraft. Es genügt nicht zu wissen, wie etwas zu beurteilen ist, man muss auch wissen, was man beurteilt. Als ich vor einigen Semestern in Kalifornien einen Doktorandenkurs zu Luthers Theologie durchführte, fragte ich zu Beginn, wer schon etwas von Luther gelesen hatte. Niemand konnte eine Schrift benennen. Viele hatten noch nie von Luther gehört, und die wenigen, die einen Kurs in historischer Theologie absolviert hatten, hatten genau zwei Dinge gelernt: dass Luther gegen die Bauern war und gegen die Juden. Sie wussten, wie das zu bewerten ist, aber sie hatten so gut wie keine Ahnung von dem, was sie so bewerteten. Die erwartete Zustimmung zu den nahegelegten Werturteilen war an die Stelle der eigenen Erarbeitung gründlicher Sachurteile getreten. Wo die Übernahme von Werthaltungen aber für wichtiger gehalten wird als die Erarbeitung eigener Kenntnisse, werden die humanities ideologisiert. Zwar ist es richtig, dass Bildungsprozesse nicht nur Kenntnisse vermitteln, sondern dazu befähigen sollten, sich diese durch eigene Urteile anzueignen. Die eigene Urteilskraft wird aber nicht befördert, wenn Studierenden Wertungen beigebracht werden und nicht die Sachurteile, auf denen sie basieren. Sie müssen lernen, selbst zu urteilen. Und das tun sie nicht, wenn sie ohne Sachkenntnis den Wertungen anderer zustimmen.
Doch das ist nicht die einzige Misere im gegenwärtigen Theologiestudium. Die andere ist, dass es keinen Kanon gibt, was eigentlich dazugehört und was nicht. In den USA ist das überall mit Händen zu greifen: Wer Theologie studiert, studiert das, was an seinem Ort gerade als Theologie gelehrt wird. Individueller geht es kaum. Am Ende haben zwar alle einen ähnlich klingenden akademischen Grad. Aber was sie studiert haben, lässt sich kaum vergleichen und stellt keine Basis dar für gemeinsames Fragen, Denken oder Handeln. Wo aber theologisch jeder und jede nur die je eigenen Ansichten vertritt und es keine gemeinsame Text-, Problem- und Diskussionsbasis mehr gibt, übernehmen zeitgenössische Ideologien die Leitung, weil sie bieten, was das Theologiestudium nicht mehr bietet: einen gemeinsamen Orientierungshorizont, in dem man sich über existenzielle Fragen verständigen und über kontroverse Antworten streiten kann. Das Resultat solcher Ausbildungsprozesse sind gemeinsame moralische Werthaltungen, aber keine gemeinsamen theologischen Kenntnisse mehr. Und was das für die kirchliche Arbeit bedeutet – das primäre Berufs- und Tätigkeitsfeld vieler, die Theologie studiert haben – ist in Gemeinden und Kirchen überall mit Händen zu greifen.
Was also wären Ausblicke? Drei Hinweise müssen genügen.
Zum einen scheint es an der Zeit und auch wissenschaftlich und ökumenisch sinnvoll, verschiedene christliche Theologien nach dem Frankfurter Modell als Studiengänge in einer Fakultät zusammenzufassen – nicht als Vermischungsplattform, sondern als gegenseitige Herausforderung zur kritischen Auseinandersetzung. Christliche Theologie sollte ein eigenständiges Studienfeld werden – mit konfessionellen und praktischen Schwerpunkten und Studienprogrammen, einschließlich evangelikaler und pentekostaler Entwicklungen, aber nicht vermischt mit anderen religiösen oder weltanschaulichen Traditionen. Das Christentum ist keine religiöse Gruppenideologie, sondern zielt auf deren Überwindung, indem es Menschen für Gottes Gegenwart sensibilisieret, der überall am Werk ist und alles zu seiner Schöpfung macht. Und christliche Theologie sollte die gelebte christliche Vielfalt im Denken nicht einfach wiederholen, sondern nach dem fragen, was diese zur Vielfalt gelebten Christentums macht. So gewiss konfessionelle Eigentümlichkeiten in den Ausbildungsprozessen der Kirchen auch künftig ihre Rolle spielen werden, so wenig muss das bedeuten, dass dies akademisch zu institutionellen Trennungen (also verschiedenen Theologischen Fakultäten) führen muss. Auch die Abgrenzung akademischer Theologie von evangelikalen, charismatischen und pentekostalen Entwicklungen ist obsolet und überholt. Es sind alles Varianten christlicher Theologie, die in ihrer Unterschiedlichkeit im Studienfeld christlicher Theologie ihren Ort haben können.
Alle Formen christlicher Theologie – das ist das Zweite – haben nicht nur exegetische, hermeneutische, historische und praktische, sondern normative Aufgaben. Christlicher Theologie geht es nicht nur um das, was war und ist, sondern um das, was sein kann und sein soll, nicht nur um das Verstehen der historischen und empirischen Christenheit, sondern um das Christentum, das immer im Werden, aber niemals einfach da ist. Ihr Thema ist nicht das empirische Christsein, sondern das existenzielle Christwerden – innerhalb und außerhalb der Christenheit. Wer meint, die Christenheit läge in ihren letzten Zügen, fällt seinem europäischen Tunnelblick zum Opfer. Das Christentum lebt und die Christenheit verändert sich ständig weiter – nicht immer so, wie es einem gefällt, aber gerade das macht deutlich, warum es theologischer Kritik und Reflexion und Begleitung bedarf. Ohne dass Menschen Christen werden, gibt es keine Christenheit. Christ wird man aber nicht dadurch, dass man sich zur Christenheit hält, also einer Kirche beitritt und Mitgliedsbeiträge zahlt, sondern dass man vom Christentum erfasst wird, also Glied am Leib Christi wird.
Dafür steht die Taufe. Das Christwerden im theologischen Sinn (Taufe) und das Christwerden im gesellschaftlichen Sinn (Kirchenmitgliedschaft) sind daher wohl zu unterscheiden (und deshalb auch die Taufe als kirchliches Ritual und als göttliches Verheißungshandeln). Während der Tauftag eines jeden Kirchenmitglieds aber jeden Tag weiter in die Vergangenheit rückt, ist die Taufe jeden Tag Gegenwart, weil sie das freie und unverdiente Einbezogenwerden von Menschen in die Gegenwart von Gottes Liebe markiert. Das erste signalisiert das gesellschaftliche Christein coram mundo (das immer Resultat menschlichen Tuns ist: „Ich will Christ werden“), das zweite das geistliche Christwerden coram deo (das immer und ausschließlich ein Wirken Gottes am Menschen ist: „Ich will Dein Gott sein und mache Dich zu meinem Kind und Erben“). Beides gehört zusammen, ist aber stets zu unterscheiden, weil es das erste nicht gibt ohne menschliche Aktivität, das zweite dagegen nur gibt ohne jede menschliche Aktivität. Es ist die Schöpfung des neuen Menschen, die nicht das Geschöpf bewirkt, sondern in der allein der Schöpfer wirkt und dem Geschöpf alles zukommt.
Weil es um dieses Werden geht, ist christliche Theologie nie nur die Entfaltung des Systems der Lebensregeln und Lebensformen einer bestimmten religiösen Gruppe, sondern die Analyse des Neuwerdens gottblinder Menschen und der Neuausrichtung menschlichen Lebens an dem, was für alles Existierende gilt: dass wir Geschöpfe sind, die von der Zuwendung des Schöpfers leben. Weil sie auf dieses Schöpfungshandeln Gottes gerichtet ist, der stets Neues möglich macht, indem er Leben aus Tod, Gutes aus Üblem, Sein aus Nichtsein schafft, ist christliche Theologie prinzipiell universal ausgerichtet, also nicht am Gegensatz zwischen Christen und Nichtchristen orientiert (also nur eine für die Kirchen relevante Reflexionsform des christlichen Glaubenslebens), sondern am Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf (also eine für alle Menschen relevante Reflexionsform der theologischen Grundlagen des christlichen Glaubenslebens). Was sie durchdenkt, betrifft alle, und wenn es nicht alle betrifft, betrifft es niemand.
Deshalb – letzter Punkt – gehört die konsequente Ausrichtung auf Gott, wie er sich in und durch Christus als Liebe erschlossen hat und im Wirken des Geistes immer wieder erschließt, zum Kern christlicher Theologie. Ohne Schöpfer keine Schöpfung, und ohne Überwindung der Gottesblindheit kein Leben als Geschöpf unter Geschöpfen in der Ausrichtung am Schöpfer. Gott ist keine Kurzformel für kirchliche Moralappelle, sondern das Lebenszentrum der Schöpfung, der, dem sich alles andere verdankt. Entsprechend steht das Neuwerden durch Gottes Zuwendung und die Neuausrichtung der Menschen an dieser stets vorausgehenden Zuwendung Gottes im Zentrum des Christentums – alles andere dagegen steht an zweiter Stelle.
Dieses Gefälle gilt auch für die christliche Theologie. Es gibt keine Theologie ohne Ethik, keinen Glauben ohne Moral, kein Hoffen ohne Gutestun. Aber Ethik ist kein Ersatz für Theologie, Moral kein Ersatz für Glauben, Gutestun kein Ersatz für das Hoffen auf Gott. Nie dürfen die ethischen Folgen des Glaubens zur Prämisse des Glaubens oder zum primären Inhalt des theologischen Denkens werden. Nur durch ihre Ausrichtung an der Gottesthematik steht die Theologie auf eigenem Boden. Nur dadurch werden die verschiedenen theologischen Disziplinen zu verschiedenen theologischen Fragehinsichten. Und nur so bleibt Theologie auch gegenüber den Ansprüchen und Erwartungen der Kirchen eine kritisch-eigenständige Unternehmung.
Denn auch diese Differenz ist wichtig – gerade für die akademische Theologie. Sie ist kein Organ der Kirchen und nicht von deren Anweisungen und Erwartungen abhängig. Sie macht die Kirchen aber auch nicht überflüssig, weil sie selbst alle Antworten hätte. Im Gegenteil. Sie irrt sich ständig, und sie muss sich immer wieder korrigieren. Ihre theologischen Konstrukte sind keine Antworten auf die existenziellen Fragen der Menschen, sondern im geglückten Fall allenfalls Hinweise darauf. Für sich betrachtet, ist christliche Theologie keine Antwort-, sondern eine Fragedisziplin. Sie widersetzt sich jeder Einschränkung oder Neutralisierung von Fraglichkeit. Sie stellt Fragen, auch und gerade an die Kirche, und sie stellt alles in Frage, auch ihr Infragestellen selbst.
Die entscheidenden Antworten des Christentums sind deshalb nicht von der Theologie, sondern vom Evangelium, von der Kirche, vom Glauben zu erwarten. Dort gehen die Antworten dem Fragen voraus. In der Theologie dagegen werfen alle Antworten neue Fragen auf. Gut ist Theologie daher nicht, wenn sie auf alles eine Antwort hat, sondern wenn sie fragwürdig bleibt. Will sie mehr, übernimmt sie sich. Will sie weniger, kann man auf sie verzichten. Aber sie wird langweilig oder gefährlich, wenn sie ihre eigene Fragwürdigkeit gar nicht mehr bemerkt. Sie meint dann Antworten zu haben. Aber sie hat nur Fragen. Denn Antworten gibt es bei existenziellen Fragen nur im Leben – im je eigenen Leben. Und sie werden nicht von der Theologie gegeben, sondern bei Gott gefunden.
